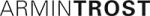Center of Expertise. Network of Experts
Vom Center of Expertice zum Network of Experts
„HR kann im Grunde jeder“ hört man so manche Kollegen zuweilen sagen. Diese Ansicht ist schlichtweg falsch. Nicht selten wird sie durch den Hinweis ergänzt, es käme eher auf Business-Erfahrung an. Können Sie eine wirksame Employer-Branding-Kampagne entwickeln und umsetzen? Sind Sie in tarifrechtlichen Fragen sattelfest? Können Sie eine HR-IT-Lösung implementieren? Wissen Sie, worauf es bei der Einführung einer Fachkarriere ankommt? Wissen Sie, was zu tun ist, wenn man akut 30 Softwareentwickler gewinnen und einstellen muss? Die Antwort ist für Nicht-Personaler und selbst für die meisten Personaler klar: Fünf mal „Nein“. Es gibt ein simples wie wahres Grundprinzip, wonach fachliche Komplexität grundsätzlich Expertise erfordert. Dies ist in anderen Funktionen, wie Einkauf, Finanzen, Marketing, Logistik nicht anders. Die Beantwortung der obigen Fragen erfordern genau das, wenn man die Dinge richtig machen möchte.
Unternehmen, die dem verbreiteten Dave-Ulrich-Modell bzw. Drei-Säulen-Modell der Personalorganisation folgen, haben diese Experten in einer eigenen Einheit gebündelt. Wir sprechen vom so genannten Center of Expertice (CoE), das in der Regel im Headquarter angesiedelt ist. Meist spielen sie den so genannten HR Business Partnern, die direkt mit den Fachbereichen zusammenarbeiten die Bälle zu und unterstützen aus der zweiten Reihe heraus. Darüber hinaus entwickeln sie zum Teil umfangreiche Konzepte mit strategischer Bedeutung: Ein neues Talent Management. Eine agile Neuauflage des Performance Management etc. Man hat normalerweise weder mit Menschen noch mit dem Business direkt zu tun. Gegenstand der Bemühungen sind Systeme, Prozesse, Instrumente, KPIs.
Genau darin liegt das Problem. Ich kenne sehr viele HR-Experten in CoEs und bin von deren fachlichem Tiefgang, ihrem Reflexionsvermögen und ihrem inhaltlichen Verständnis nicht selten beeindruckt. Das sind wirklich Profis. Gleichzeitig beobachten wir, dass deren Arbeit viel zu häufig an der Realität vorbei geht, die Ergebnisse zu kompliziert sind, keine Wirksamkeit entfalten, sich manchmal für das Business sogar als schädlich erweisen. Das wollen diese Kollegen im HR nicht. Im Gegenteil. Sie wollen einen guten Job machen, wie Andere in anderen Funktionen auch. Das Problem ist struktureller Art. Center of Expertice sind strukturell zu weit von jenen Bereichen getrennt, innerhalb derer sie eigentlich wirken sollen. CoEs sind Silos jenseits der betrieblichen Realität. Darüber hinaus erleben sie die Konsequenzen ihres Handelns nicht, was Feedback und dadurch Lernen unmöglich macht. Feedback kommt von der nächst höheren Ebene aber selten aus dem Business selbst. Das ist in gewisser Weise toxisch.
Ich gehe davon aus, dass sich Unternehmen zunehmend von dieser Organisationsform distanzieren werden. Anstatt dessen werden sie wahrscheinlich auf Netzwerke fachlicher Experten setzen – Networks of Experts (NoEs). NoEs sehen sich in erster Linie den jeweiligen personalrelevanten Herausforderungen gegenüber verpflichtet und jenen Kollegen, die mit diesen konfrontiert sind. Von Letzteren erhalten sie auch nicht nur ihre Aufträge sondern unmittelbares Feedback. Bei Experten kann es sich um Interne wie Externe handeln. Gerade bei Herausforderungen, die mit einer hohen sozialen Dynamik verbunden – und das ist im HR-Kontext häufig der Fall – arbeiten NoEs eng mit Kollegen aus den Fachbereichen zusammen und teilen die Verantwortung.
Die Liste möglicher, beispielhafter Einsätze ist endlos. Ein Unternehmensbereich sucht möglichst schnell deutlich mehr Data Scientists, als der Markt offenbar hergibt. Ein anderer Unternehmensbereich wird mit einem weiteren Bereich zusammengelegt. Es ergibt sich daraus eine Vielzahl personalrelevanter Fragestellungen. Eine Division denkt über ein neues, variables Vergütungssystem nach, das neben Teamarbeit auch Eigenverantwortung fördern soll. Dem Forschungs- und Entwicklungsbereich schwebt vor, mittels Fachkarrieren strategisch relevante Expertise langfristig zu sichern und attraktive Rahmenbedingungen für Fachexperten zu schaffen.
Einmal kommt eine Art Talent-Acquisition-Sonderkommando zum Einsatz und das Andere mal der externe, individuelle Arbeitsrechtler. Bei einem anderen Fall wiederum agieren hochprofessionelle Transformationsbegleiter, während sich an anderer Stelle erfahrene Eignungsdiagnostiker ans Werk machen. Experten befassen sich niemals mit wiederkehrenden Routinen sondern gehen dort hin, wo es brennt. Neben fachlichem Tiefgang verfügen sie über langjährige Erfahrungen in der Anwendung relevanter Arbeitsmethoden, wie sie beispielsweise in Unternehmensberatungen längst üblich sind.
All das eben Beschriebene ist Stand heute hypothetisch und soll bestenfalls zum Nachdenken anregen. Kenne ich Unternehmen, die diesen Ansatz bereits erfolgreich praktizieren? Kaum, oder nur in Teilen. Tatsächlich erlebe ich aber zahlreiche Unternehmen, die über genau diesen Weg nachdenken. Es bleibt spannend.